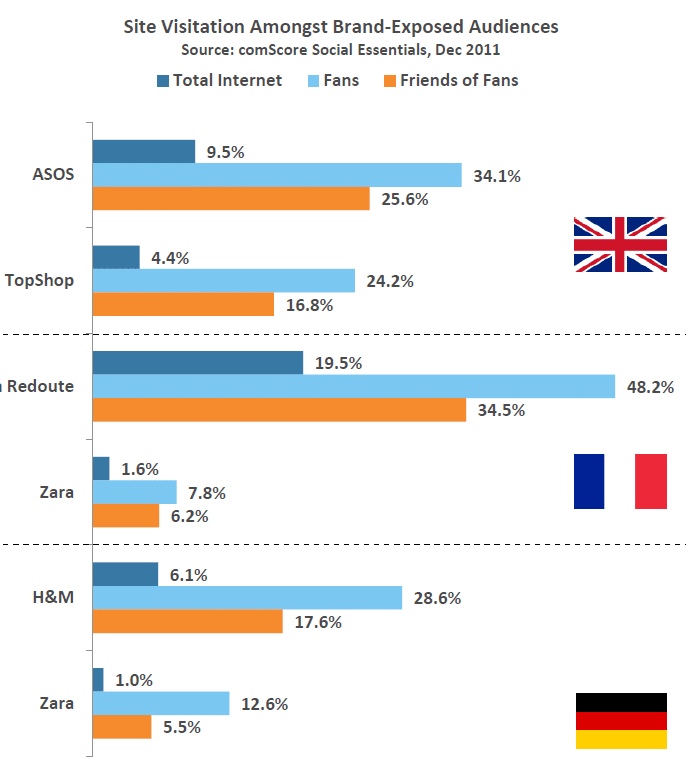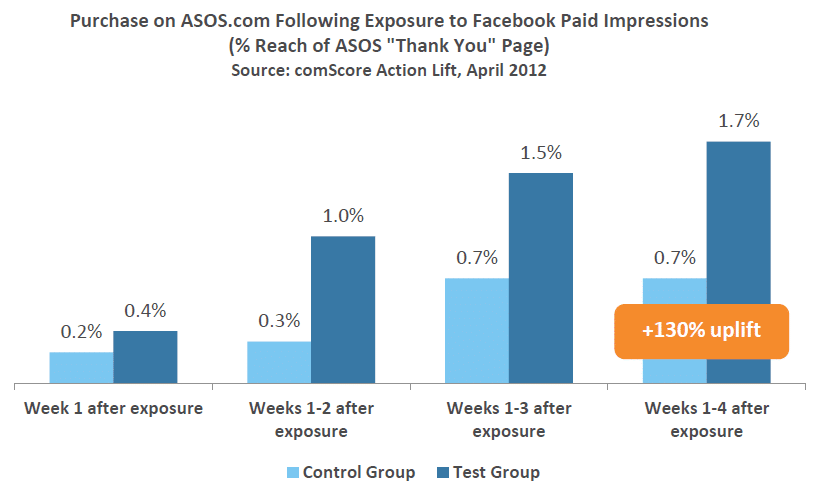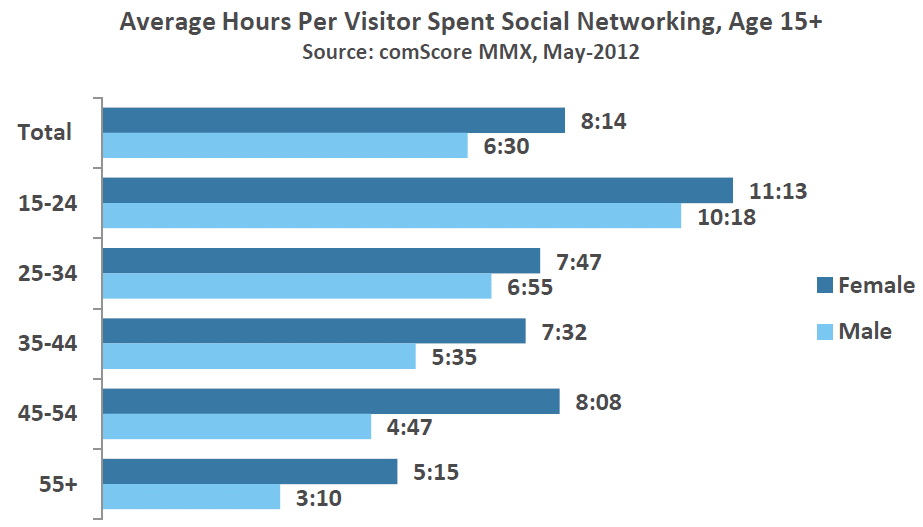Wer würde sich nicht wünschen, Employer Branding messen zu können? Das Trendence Institut hat nun zusammen mit der Ruhr-Universität und dem Chemiekonzern evonik ein Modell entworfen, das den Wert einer Arbeitgebermarke ermitteln will. “Wert” ist hier wörtlich zu nehmen. Der “Employer Brand Value Score” wird nämlich tatsächlich in Geld gemessen: Wie viel muss Unternehmen X auf mein erwartetes Mindestgehalt aufschlagen, damit ich dort arbeiten würde.
Employer Branding messen mit dem “Employer Brand Value Score”:
Um diesen Score zu ermitteln, wurden 1108 Studenten gebeten, 800 Unternehmen zu bewerten. So wurde ein “minimaler Gehaltserwartungswert” von 40.383€ p.a. ermittelt – also das Mindestgehalt, zu welchem die Absolventen bei ihrem Traumarbeitgeber anfangen würden. Je höher nun dieser mittlere Wert beim einzelnen Unternehmen liegt, desto höher der Score, desto schlechter seine Arbeitgebermarke. Das Ziel dieser Rechnung liegt auf der Hand: Vergleichbarkeit. Sollte ich nicht bei meinem Wunscharbeitgeber X für 40k arbeiten können, müsste Unternehmen Y schon 45k für mich abbuchen, Unternehmen Z gar 50k. Damit hat Unternehmen Y die bessere Arbeitgebermarke als Unternehmen Z, beide liegen jedoch fünf- bzw. zehntausend €-Punkte hinter dem Wunscharbeitgeber X.
Grundsätzlich ist dieser Ansatz nicht uninteressant und dem Brand-Equity-Modell aus dem Konsumgütermarketing entlehnt. Auch hier heißt es (stark vereinfacht): Die Zahnbürste von Oral B müsste schon einen ganzen Euro billiger sein, damit ich meine geliebte Dr.Best im Regal liegen lasse. Die Frage ist, inwiefern sich eine solche Kaufentscheidung mit der Entscheidung für oder gegen einen Arbeitgeber gleichsetzen lässt. Denkt man dieses Modell weiter, könnte die Botschaft für Unternehmen auch lauten: Einfach eine Schippe Extrageld auf das Jahresgehalt und schon sind die Mängel an der eigenen Unternehmensmarke ausgeglichen. Und auch wenn dieses Vorgehen noch oft der Praxis entspricht, sollte dies weder Weg noch Ziel von nachhaltigem Employer Branding sein. Insofern ist dieser Score sicherlich einen interessierten Blick wert, in der Bewertung aber mit Vorsicht zu genießen.
Wie seht Ihr das?