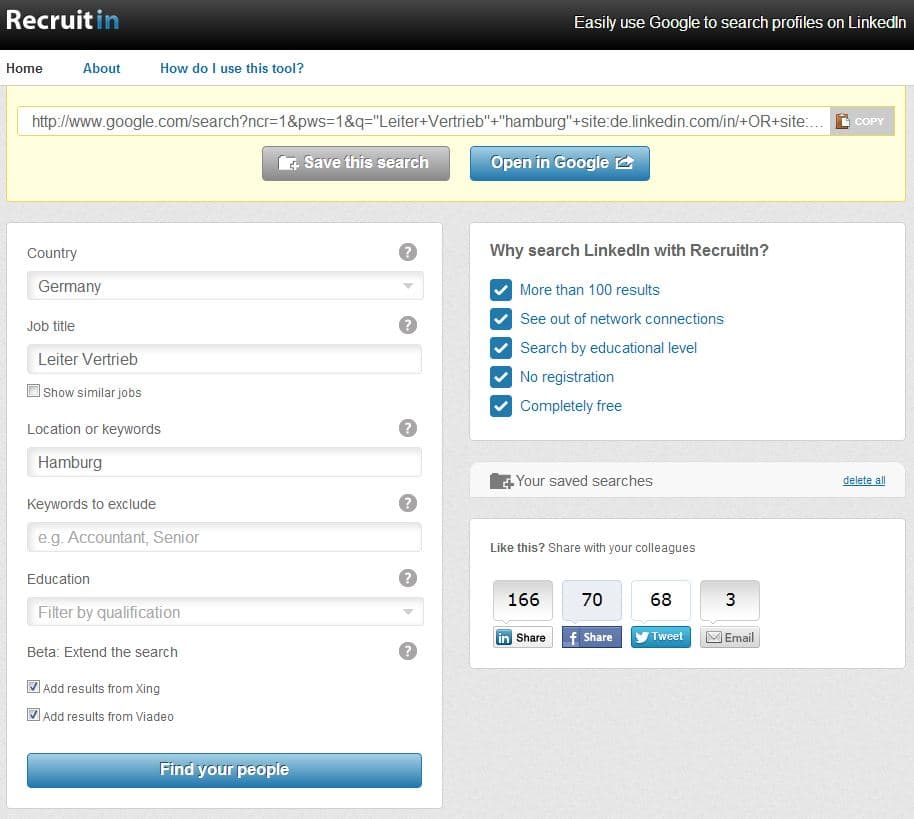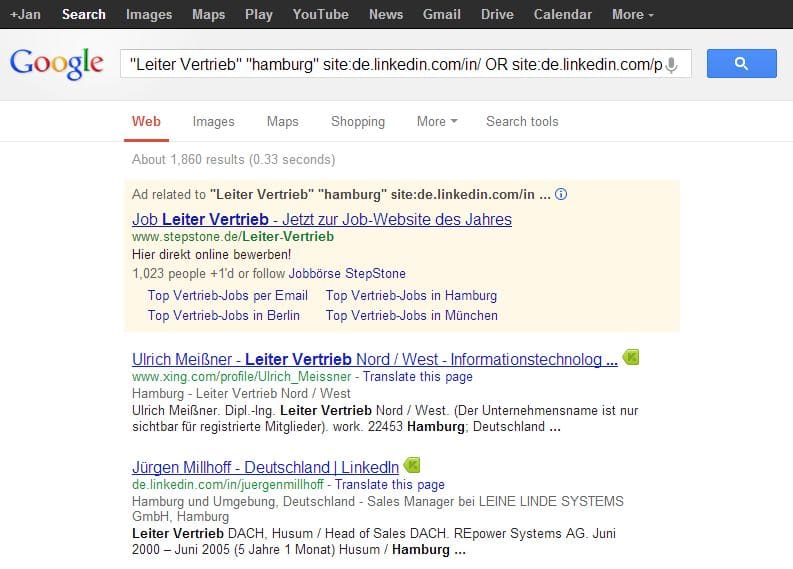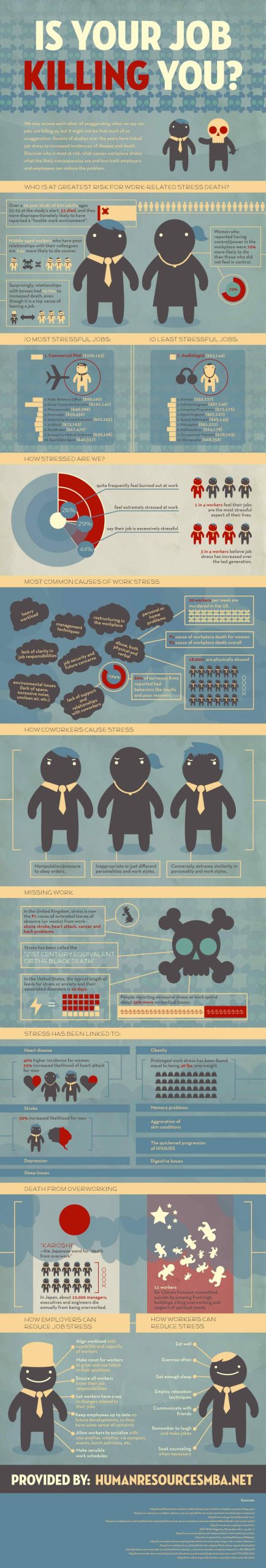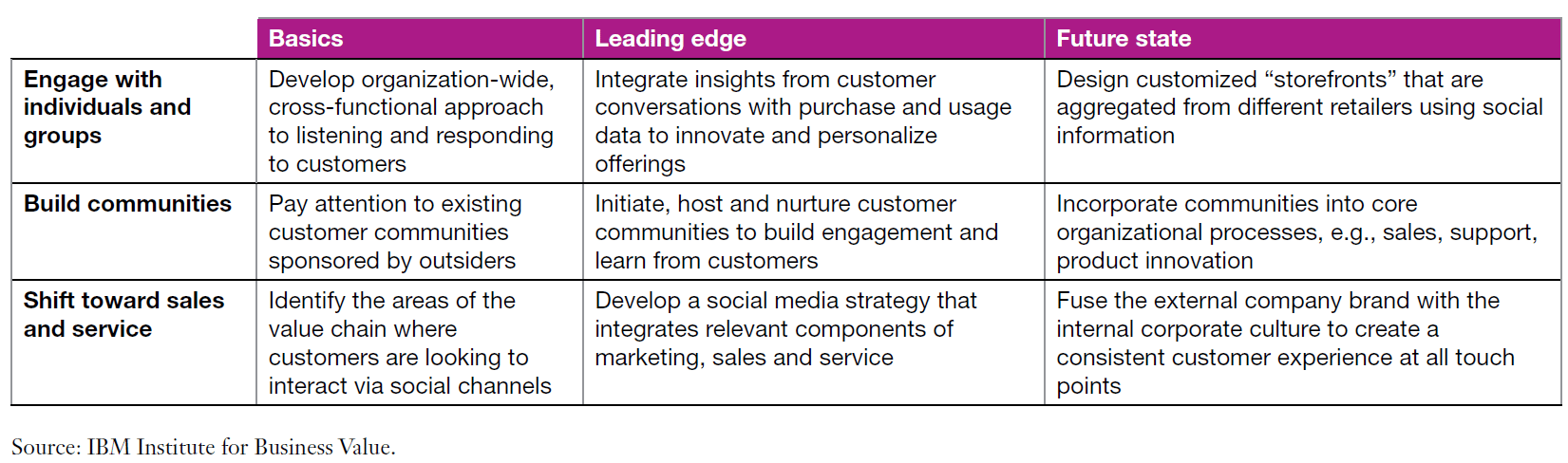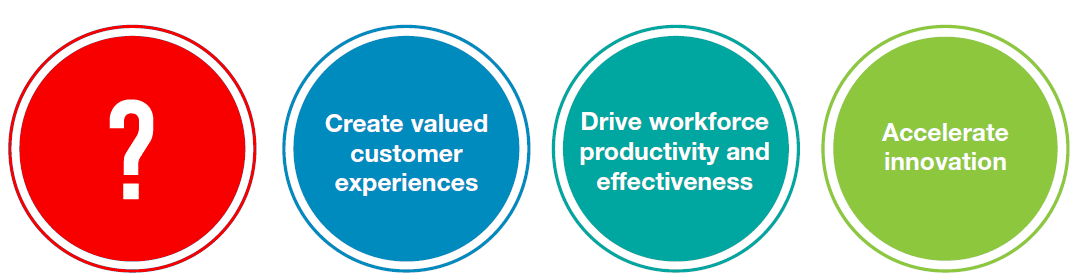“Eine nüchterne, seriöse Corporate-Page bei Facebook? Zwischen all den Katzenbildern, Videos und Ragefaces kann das doch nicht funktionieren.” Derartigen Vorbehalten begegnen wir in der Beratung öfter. Und in der Tat: Deine mittelständische Metallwalzenfabrikation hat es schwer gegen Red Bull, Disney und Victoria Secret. Da gibt es gar nichts zu beschönigen: Fernab des freien Marktes, werden diese Unternehmen plötzlich zur direkten Konkurrenz um die Blicke und einige wertvolle Sekunden in der Aufmerksamkeit Deiner Fans. Und das ist ein harter Kampf…
…aber kein verlorener. Also Samthandschuhe ausziehen und sehen, wo Du Gegnentreffer landen kannst. Deine Weihnachtsfeier gegen die Victoria Secret Fashion Shows am 4. Dezember. In Sachen Pomp, Preis und Promis unangreifbar. Davon landet allerdings meist nur eines im Facebook-Stream der Nutzer: Bilder. Und genau hier liegt der Schlüssel der vielen Kleinen die große Erfolge feiern. Sie liefern viele Bilder, Grafiken und Videos.
Ich weiß, das ist erstmal noch keine große Neuigkeit. “Viele Bilder” steht in jeder Facebook-Tippsammlung. Aber selten wird deutlich gemacht, welchen Wert diese Blickfänger für Deine Markenbotschaft haben. Und noch seltener wird klar gesagt: Investiert in diese Bilder! Ihr braucht viele davon. Gute! Regelmäßig. Alben. Klar, auch ein iPhone-Foto hat seinen Charme, aber anzunehmen, dass der Prakti in der Kantine den gesamten Bildercontent für die Facebook-Page zusammenknipsen kann, ist ein großer Fehler. Social Media ist eben auch Media, und wenn diese billig und lieblos gemacht sind, wird da nicht viel social nachkommen. Nehmt etwas Geld in die Hand, entwickelt ein visuelles Konzept und setzt es professionell um, das wirkt!
Ich folge auf Facebook vielen kleinen Straßenrap-Labels/Künstlern (aus Rücksicht auf unsere zarten Leser verzichte ich auf eine Verlinkung 😉 ). Diese Jungs und Mädels haben nun wirklich kein Budget, aber das was sie haben, setzten sie klug ein. Jeden Tag Bilder, Grafiken, Zeichnungen, keine Videoclips. Mit Mühe und Liebe gemacht. Und jeden Tag werden sie mit starken Interaktionsraten belohnt.
Passend dazu: Eine sehr schöne Präse von der conceptbakery: Das „Branded Visual Content Theorem“. Warum spielen Bilder eine so große Rolle in Social Media:
[slideshare id=15373212&doc=presentationrevised-2-121127122545-phpapp02]